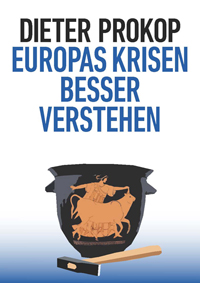PROKOP, Dieter
(2016): Europas Krisen besser verstehen. Tredition Verlag,
Hamburg. Auch als eBook.
"Die Krisen der EU versteht man besser, wenn man sie im
Zusammenhang mit den Institutionen und Grundproblemen der EU
betrachtet und etwas darüber erfährt, wie die Krisen
einander bedingen und welche Pokerspiele um Hegemonie und Führungsmacht
in Europa gespielt werden."
Einleitung
Europa ist, abgesehen vom Binnenmarkt, auch ein utopisches Projekt:
Nie mehr Krieg in Europa! (Den Kosovo-Krieg der NATO, den die
rot-grüne Bundesregierung 1999 mitgemacht hat, betrachtet
man als Ausrutscher.) Europa ist ein demokratisches Projekt.
Also ein freiheitliches Projekt der Realisierung der Menschenrechte.
(Das Demokratie-Defizit der EU als Organisationsform betrachtet
man als vorläufig.)
Europa ist auch ein Raum, in dem sich Viele der Schuld bewusst
sind, die ihre Vorfahren ihnen aufgeladen haben, von der Inquisition
und den Kreuzrittern über den Kolonialismus und Imperialismus
bis zum Holocaust und zu den Weltkriegen, die die Deutschen entfesselt
haben. Das Bedürfnis, etwas davon heute wieder gut zu machen,
ist groß.
Das Faszinierende an Europa ist auch dessen Vielfalt, nicht nur
der Staatsformen und deren Geschichte, sondern auch der Lebensqualitäten.
Zur Utopie Europas gehört auch die Toleranz gegenüber
anders Denkenden und Lebenden. Berechtigt ist der Unmut der europäischen
Bürger, dass die EU die europäische Vielfalt zerstört,
durch vereinheitlichende Vorschriften, und regulierende Einmischungen
in den Alltag. Die EU tut das, weil die großen Konzerne,
die auf dem - wünschenswerten - freien europäischen
Binnenmarkt agieren, die Vereinheitlichung wollen, allen voran
die Konzerne der deutschen Exportwirtschaft.
Nur reichen Festreden und Versöhnungszeremonien, idealistische
Entwürfe und auch offensive Forderungen nicht aus, um Europa
als Friedensprojekt, als Versöhnungsprojekt und auch als
Projekt schillernder Vielfalt der Lebensweisen gerecht zu werden.
In der Politik ist hierfür Realismus erforderlich und in
der Wissenschaft werden realistische Analysen gebraucht, die
untersuchen, warum das Wünschenswerte nicht zustande kommt.
Wünschenswert ist auch die Vermeidung oder gar Lösung
der vielen Krisen der Europäischen Union. Sie sind mein
Thema. Die Krisen der EU versteht man besser, wenn man sie im
Zusammenhang mit den Institutionen und Grundproblemen der EU
betrachtet und etwas darüber erfährt, wie die Krisen
einander bedingen und welche Pokerspiele um Hegemonie und Führungsmacht
in Europa gespielt werden:
Die Einführung des Euro hatte die Schuldenkrise, vor allem
die Griechenlandkrise zur Folge, die wiederum Rettungsmaßnahmen
zur Erhaltung des Euro notwendig machte: die Geld-Transferunion
('Rettungsschirm') und die Austeritätspolitik. Also versteht
man den Rettungsschirm und die Austeritätspolitik nur, wenn
man die Problematik einer zentralen Währung von Staaten
mit höchst unterschiedlichen ökonomischen, politischen,
gesellschaftlichen Strukturen kennt.
Die Austeritätspolitik und die Strukturreform-Auflagen gegenüber
Griechenland haben dazu geführt, dass Griechenland keine
Möglichkeit zum Schutz der Schengen-Außengrenze (und
kein Interesse hieran) hatte und illegal Eingereiste illegalerweise
durchreisen ließ. Also versteht man das Durchwinken der
Flüchtlinge nach Ungarn, Österreich, Deutschland, Schweden
etc. nur, wenn man die Austeritätspolitik bzw. die Politik
der Strukturreform-Auflagen kennt und beurteilen kann.
Die Brexit-Krise versteht man nur, wenn man die Subsidiaritäts-Debatte,
die Forderung nach mehr Demokratie und Selbstbestimmung wahrnimmt.
sei es in der EU oder, nach dem Brexit, eben außerhalb
der EU. Und wenn man diese legitime Forderung von fremdenfeindlichem
Nationalismus zu unterscheiden weiß.
Und ich meine auch, dass man die Flüchtlingskrise falsch
versteht, wenn man sie ausschließlich als Flüchtlingskrise
betrachtet. Das "Wir schaffen das" war auch ein Mittel,
um den Forderungen Frankreichs nach einer verstärkten Integration
der Euro-Staaten ein 'starkes Deutschland' entgegenzusetzen,
denn in diesem 'Kerneuropa' wären Frankreich und die Euro-Südstaaten
in der Mehrheit. Der deutsche Umgang mit der Flüchtlingskrise
war also auch ein Spielzug im Pokerspiel um die Führungsmacht
('Führungsverantwortung') in der Europäischen Union.
INHALTSVERZEICHNIS
Einleitung
DAS INSTITUTIONELLE EUROPA
Vorbemerkungen
EUROPAS INSTITUTIONELLE GRENZEN
| Teil
I: Die fehlende Demokratie |
| Kapitel
1: |
Die
institutionelle Grenze zwischen dem Binnenmarkt und den
Bürgerrechten |
| |
|
| Teil
II: Die lähmende Wirkung des Euro |
| Kapitel 2: |
Die institutionelle
Grenze, die die Europäische Währungsunion gegenüber
der Selbstverantwortung
für die eigene 'Volkswirtschaft' setzt |
| Kapitel 3: |
Die Realisierung
von Bürgerrechten wie Sozialleistungen und Allgemeinwohl-Leistungen
gibt es nur, wenn die einzelnen Staaten oder wirtschaftlich gleichstarke Staaten
ihre Leistungsbilanz selbst steuern können |
| |
EUROPAS
KRISENHAFTE ENTSCHEIDUNGEN |
| |
| Vorbemerkungen |
| |
|
DER
LÄSSIGE UMGANG MIT DEN EU-VERTRÄGEN UND
UNTERSCHIEDLICHE WIRTSCHAFTSPOLITISCHE STRATEGIEN |
| |
|
| Teil
III: Die Strategie: Neuverschuldung, Wachstum und die
gemeinsame Finanzierung von Schuldnerstaaten |
| Kapitel 4: |
Die Schuldenkrise
nach der Einführung des Euro: Einführung des
'Moral Hazard', des
verantwortungslosen Schuldenmachens, in die Politik der
Euro-Staaten |
| Kapitel 5: |
Deutschland,
der gnadenlose Konkurrent in Europa |
| Kapitel 6: |
Die Griechenlandkrise
und Eurokrise von 2010 und der von Frankreich durchgesetzte
European Stability Mechanism (ESM): ein europäischer Staatsfinanzierungs-Mechanismus |
| |
|
| Teil
IV: Die Strategie: Lohnzurückhaltung, Austerität
und Reformauflagen für Schuldnerstaaten |
| Kapitel 7: |
Der von Deutschland
durchgesetzte Fiskalpakt von 2012 / 2013 und das 'Europäische
Semester': Sparmaßnahmen und Haushaltskontrollen |
| |
|
DAS
DEUTSCHE IMAGEPROBLEM BIS JULI 2015:
'DAS KALTHERZIGE DEUTSCHLAND' |
| |
|
| Vorbemerkung |
| |
|
| Teil
V: Wie die Euro-Staaten auf deutschen Druck hin die griechische
Forderung nach einer bedingungslosen Staatsfinanzierung
ablehnten |
| Kapitel 8: |
Die Griechenland-
und Eurokrise von 2015: neue Kredite nur bei Reformen,
Sparmaßnahmen
und Beendigung der Klientelpolitik |
| Kapitel 9: |
Nationale strategische
Interessen in der Griechenlandkrise |
| Kapitel 10: |
Juli 2015 im
Stern: die Bundeskanzlerin als 'Eiskönigin' |
| |
|
| Teil
VI: Die Flüchtlingskrise als Rache der Griechen
für die Ablehnung einer bedingungslosen Staatsfinanzierung.
Und weitere Ursachen der illegalen Massenwanderung |
| Kapitel 11: |
Ab August 1015:
Griechenlands vertragswidriges Durchwinken von illegalen Massenwanderungen
nach Deutschland |
| Kapitel 12: |
Ursachen der
illegalen Massenwanderung: die Globalisierung, die 'failed
states' und
der 'Jugendüberhang' in den Ursprungsstaaten |
| Kapitel 13: |
Der Menschenschmuggel,
ein Milliardengeschäft für Schlepperbanden, Betrüger,
Täuscher
und korrupte Staatsbeamte |
| |
|
| INSTITUTIONELLE FEHLENTSCHEIDUNGEN
BEI DEN EUROPÄISCHEN VERTRÄGEN
ÜBER FLÜCHTLINGE, ASYL UND GRENZSCHUTZ |
| |
|
| Teil
VII: Die erstaunlich unzulänglichen Verträge
von Schengen und Dublin |
| Kapitel
14: |
Das legale Reisen
im und in den Schengen-Raum: innen frei, außen visumspflichtig |
| Kapitel
15: |
Was der Begriff
'Flüchtlinge' nach der Genfer Flüchtlingskonvention
bedeutet: politisch
Verfolgte, nicht mehr und nicht weniger |
| Kapitel
16: |
Die Unzulänglichkeiten
der EU-Grenzschutzorganisation Frontex, die keine Grenzschutzpolizei
sein darf |
| Kapitel
17: |
Kein Recht auf
Flüchtlingsstatus und Asyl: Arbeitslose bzw. Arbeitsuchende
('Wirtschaftsmigranten') und ausschließlich Sozialleistungen
Beanspruchende ('Sozialmigranten') |
| Kapitel
18: |
Der vernachlässigte
Schutz der Schengen-Außengrenzen. Erst rein, dann
wieder raus
- das grausame Spiel der EU mit den illegal Einreisenden |
| |
|
Teil
VIII: Ein Staat kann den Bürgern anderer Staaten
nicht grenzenlos helfen, denn er hat die Rechte der eigenen Bürger zu beachten |
| Kapitel
19: |
Privates und öffentliches
Eigentum: ein Menschenrecht und ein Bürgerrecht |
| Kapitel
20: |
Warum ein Staat
wertvolle öffentliche Güter nicht grenzenlos
an die Bürger anderer
Staaten veräußern darf |
| Kapitel
21: |
Im Extremfall
- aber nur dann - steht das Bürgerrecht auf rechtsstaatliche,
geordnete Verhältnisse über dem Flüchtlings- und Asylrecht |
| |
|
DIE
DEUTSCHE IMAGEKORREKTUR AB SEPTEMBER 2015:
VOM 'KALTHERZIGEN DEUTSCHLAND'
ZUM 'HUMANEN DEUTSCHLAND' |
| |
|
Teil
IX: Die kommerzielle Opfer-Show im Fernsehen und
die 'Willkommenskultur' in Deutschland |
| Kapitel
22: |
Warum die News-Agenturen
und Redaktionen wollen, dass die Kamerateams ihnen aus
Krisengebieten keine sachliche Berichterstattung liefern,
sondern anrührende Bilder von weinenden Kindern und
verzweifelten Müttern |
| Kapitel
23: |
5. September
2015: 'Merkel öffnet die Grenzen, aus humanitären
Gründen'. Die Kanzlerin im Spiegel als 'Mutter Theresa'.
Das 'humane Deutschland', grenzenlos hilfsbereit gegenüber
allen Opfern der Verhältnisse |
| Kapitel
24: |
Tatsachen, die
gegen eine Romantisierung der illegalen Massenwanderungen
sprechen |
| |
|
DER
EUROPÄISCHE OPTIMALISMUS |
| |
|
| Vorbemerkungen |
| |
|
| Teil
X: Rigorose Selbstgewissheit |
| Kapitel
25: |
Das große
schöne reine 'Wir' und die idealisierte conditio humana |
| Kapitel
26: |
Wer menschlich
sein will, kann nicht einfach kategorischen Imperativen
folgen, sondern ist verpflichtet, Regeln der Angemessenheit
zu beachten |
| Kapitel
27: |
Selbstgewissheit,
die Wurzel des Guten wie des Bösen. Hegels Kritik
an Kants kategorischem Imperativ |
| Kapitel
28: |
Das Gute und
das Böse im Recht und in der Rechtsprechung |
| Kapitel
29: |
Der imperiale
Hype der Europäischen Union |
| Kapitel
30: |
Auch rationale
Gesellschaftsverträge können ins Böse umkippen |
*
* * |
| Kapitel
31: |
Exkurs in die
Literatur. Shakespeares Othello. Wie selbst hinter rationalen
Gesellschaftsverträgen 'der Mensch ein Wolf für
den Menschen' bleibt |
| |
|
DER
DEUTSCHE IDEALISTISCHE HYPE |
| |
|
| Vorbemerkungen |
| |
|
ZWEI
SOZIOLOGISCHE ERKLÄRUNGSVERSUCHE |
| |
|
| Teil
XI: Die 'Willkommenskultur' - eine Folge multikultureller
Behauptungskämpfe und politisch korrekter Opfer-Mythen? |
| Kapitel
32: |
Multikultur als
Kampf aller gegen alle. Ein kurzes satirisches Stück |
| Kapitel
33: |
Wie in den multikulturellen
Profilierungs- und Behauptungskämpfen das Mitleid
mit den Opfern als politisch korrektes Kampfmittel missbraucht
wird |
| Kapitel
34: |
Hinter den Kulissen
des pauschalen Mitleids mit allen Opfern: Interessen der
Sozialberufe an Staatsstellen und Staatsaufträgen
- legitime, aber partikulare Interessen |
| |
|
| Teil
XII: Das Aufgreifen der 'Willkommenskultur' durch die
Bundeskanzlerin - eine Folge wahlkampfstrategischer Überlegungen? |
| Kapitel
35: |
Imagepflege und
die Markt- und Meinungsforschungs-Falle. Warum die Markt-
und Meinungsforschung der Politik nur dabei hilft, Gefühle,
Stimmungen in der Bevölkerung anzusprechen, nicht
aber deren Verstand |
| Kapitel
36: |
Warum das "Wir
schaffen das" virtuell und darin populistisch war |
*
* * |
| Kapitel
37: |
Exkurs über
Erzählstrukturen in der Literatur. Warum es auch in
der Politik keine Schande ist, populär sein zu wollen,
Popularität jedoch etwas fundamental Anderes ist als
Populismus |
| |
|
DIE
MACHT IN EUROPA |
| |
|
| Vorbemerkungen |
| |
|
DIE
FLÜCHTLINGSKRISE ALS POKERSPIEL
UM DIE MACHT IN DER EU.
UND EIN NEUES IMAGEPROBLEM AB JANUAR 2016:
'DEUTSCHLAND ALLEIN' |
| |
|
Teil
XIII: Der Anspruch auf deutsche 'Führungsverantwortung'
und
der Widerstand der Anderen |
| Kapitel
38: |
Die Schengenkrise
ab Februar / März 2016: Österreich-Ungarn widersetzt
sich Merkel. Die Verriegelung der Balkanroute von Mazedonien
und Ungarn bis Österreich |
| Kapitel
39: |
Januar 2016 in
der Presse: die Kanzlerin als 'Die Einsame'. Deutschland
'allein in Europa' |
| Kapitel
40: |
Deutsches Europa?
Französisches Europa? |
| Kapitel
41: |
Die Flüchtlingskrise
- mehr als eine Migrationskrise: ein Pokerspiel zwecks
Positionierung für die bevorstehenden Auseinandersetzungen über
die Integration Europas |
| |
|
| Teil
XIV: Darf Europa Bündnisse mit Staaten eingehen,
die die Menschen- und Bürgerrechte nicht respektieren? |
| Kapitel
42: |
Kann das Leitbild
von 'Politik als Beruf' die amoralische Machterhaltung
sein? Durfte Max Weber diese Amoralität zur 'Verantwortungsethik'
hochstilisieren? |
| Kapitel
43: |
Wie man über
das falsch gestellte Machiavellismus-Problem hinausgehen
kann: im Praktizieren einer 'Kultur der Angemessenheit' |
| Kapitel
44: |
Ab November 2015:
Merkels Pakt mit Erdogan. Der Versuch, die Schengenkrise
zu lösen |
| |
|
| Teil
XV: Ende? gut? |
| Kapitel
45: |
Ab April 2016:
'Flüchtlingskrise gelöst'? |
| Kapitel
46: |
Ende April 2016
in der FAZ: die Bundeskanzlerin als 'Supergirl',
Verkörperung des 'starken Deutschland' an der Seite
des 'Superhelden' Obama |
| Kapitel
47: |
Folge des deutschen
Pokerspiels: die Teilung der EU in neue / alte Machtblöcke.
Gegensätzliche Interessenlagen und gegenseitige Bedrohungen |
| |
|
DIE
INTEGRATION EUROPAS |
| |
|
|
Vorbemerkungen
|
| |
|
ANSTEHENDE
INSTITUTIONELLE ENTSCHEIDUNGEN UND
KÜNFTIGE KRISEN DER EU |
| |
|
| Teil
XVI: Umverteilung. Die kommenden Attacken der EU-Südstaaten
auf das Geld der Steuerzahler und Sparer in den EU-Nordstaaten |
| Kapitel
48: |
Die künftigen
europäischen Integrations-Verhandlungen. Warum sie
zugleich Umverteilungskämpfe zwischen den EU-Staaten
sein werden |
| Kapitel
49: |
Die Europäische
Zentralbank und der deutsche Leistungsbilanzüberschuss |
| Kapitel
50: |
Tsipras pokert
erneut um den Schuldenschnitt. Die schnell eingedämmte
Griechenlandkrise von 2016 |
*
* * |
| Kapitel
51: |
Exkurs
in die Literatur. Die Grille und die Ameise. Eine Lachgeschichte,
in der behauptet wird, dass die Griechen nicht die Grille
sind |
| |
|
| Teil
XVII: Selbstbestimmung. Künftige Auseinandersetzungen
um mehr Demokratie und um eine flexiblere Währungsordnung |
| Kapitel
52: |
23. Juni 2016.
Die Brexit-Krise: Ablehnung der universalen Arbeitnehmerfreizügigkeit
und damit des Lohndumping in der EU |
| Kapitel
53: |
Die irgendwann
notwendigen Entscheidungen: Zentralismus oder Subsidiarität? |
| Kapitel 54: |
Das irgendwann
kommende Ausbrechen der schwelenden Eurokrise: Euro oder
getrennte Währungen für Norden und Süden? |
*
* * |
| Kapitel
55: |
Exkurs in die
Literatur: Adam und Eva. Denn der Kern aller europäischen
Werte ist das Interesse des Subjekts, zu erkennen, was
nützlich und was schädlich ist und das eigene
Leben selbst in die Hand zu nehmen |
|
Literaturverzeichnis
|