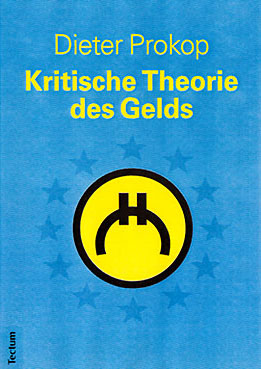PROKOP, Dieter
(2014): Kritische Theorie des Gelds. Tectum Verlag, Marburg / ISBN:
978-3-8288-1
Worum es geht
Tatbestände
Entscheidend sind heute
nicht 'freie Märkte', sondern oligopolistische
Marktverhältnisse. Entscheidend ist heute die Politik der Deregulierung,
die die Finanzwirtschat entfesselt hat.
Die Folge der Deregulierung sind Täuschungen
und Betrügereien
der Großbanken an Kleinanlegern, institutionellen Anlegern und
Staaten. Eine weitere Folge ist das Bündnis der Staaten, mit den
Banken-Konzernen: Der Staat gibt Existenzgarantien, und als Gegenleistung überfüttern
sich die Banken mit Staatsanleihen, die ihnen, wenn sie toxisch sind,
wiederum die Europäische Zentralbank abnimmt. Trickreich umgeht
die EZB das Verbot der Finanzierung anderer Staaten (Maastricht-Vertrag,
No bailout-Klausel) mit ihrem OMT-Programm, bei dem es um den unbegrenzten
Aufkauf von den Staatsanleihen von Pleitestaaten geht. Scharf am Rand
des deutschen Grundgesetzes - wenn nicht außerhalb desselben
- bewegt sich der ESM, European Stability Mechanism, der marode Staaten
und Banken auf Kosten der Steuerzahler in anderen Staaten finanziert.
Wenn man eine realistische Theorie des Gelds will, muss man diese fatalen
Tatbestände zur Kenntnis nehmen.
Interessenlagen
Die fatalen Tatbestände sind den kritischen Finanzfachleuten
bekannt. Was die von mir angestrebte kritische Theorie des Gelds zur
Analyse und zur Debatte hinzufügen kann, ist die gesellschaftswissenschaftliche
Diagnose. Diagnosen haben den Zweck, an den empirischen Vorgängen
das 'Wesentliche', in diesem Fall den gesellschaftlichen 'Trend' zu
erkennen und in Begriffe zu fassen.
Ich werde von einer 'Operation Entgrenzung' sprechen und unter diesem
Begriff die hinter all den Täuschungen, Betrügereien und
Vertragsbrüchen befindlichen strategischen Interessenlagen analysieren.
Die Operation Entgrenzung betrifft auch die entgrenzte Kürzung
aller gesellschaftlichen Einrichtungen, die dem Gemeinwohl dienen.
Das liegt am fatalen Bündnis der Staaten mit den Banken und führt
auch dazu, dass die Staaten nur noch im Interesse ihrer Staats-Bonität
handeln und nicht mehr im Interesse ihrer Bürger.
Modelle
Eine Diagnose will die wesentlichen
Grundstrukturen benennen. Dazu gehört auch die der Grundstruktur
des Gelds selbst. Also stellt sich auch die Frage: Was ist das Geld?
Was ist das Wesentliche am Geld?
Was ist die gesellschaftliche Quintessenz des Gelds?
Wenn man die Sache auf der makro-ökonomischen (und makro-politischen)
Ebene behandelt, stellt man fest: Die realen Strukturen, in denen Geld
funktioniert, sind 'der Tausch' (d.h. der Waren-Handel) und 'der Kontrakt'
(d.h. der Kredit- und Eigentums-Vertrag). Hieraus entsteht Abstraktion,
im Handeln der Akteure: Um den Wert von Waren zu erkennen oder die
Bonität von Kreditpartnern zu beurteilen, müssen die wirtschaftlichen
Akteure abstrakt denken. Die Menschen rechnen, wenn sie Geld benutzen.
Sie kalkulieren den Wert von Waren und die Bonität derer, mit
denen sie Kredit-Verträge schließen. Hierbei stellen sie
Vergleiche an, sie identifizieren Gleichwertiges, schließen Nicht-Gleichwertiges
aus. Sie entwickeln hierbei ein 'Denken in abstrakter Allgemeinheit'.
Die reine Form, das gesellschaftliche 'Wesen' des Gelds, ist also die
reale, dem realen Handeln beim Waren-Handel und beim Geld-Kontrakt
implizite Abstraktion.
Ich werde die vier grundlegenden theoretischen Werke über das
Geld darstellen, die diese Grundstrukturen des Gelds behandelten: Karl
Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie (1867);
Georg Simmel: Philosophie des Geldes (1900); John Maynard Keynes:
A treatise on money (1930: dt. Vom Gelde. 1931) und Gunnar Heinsohn und Otto Steiger:
Eigentum, Zins und Geld. Ungelöste Rätsel der Wirtschaftswissenschaft (1996).
Illusionen
Mit Hilfe dieser Modelle,
die sich auf der Makro-Ebene bewegen, diagnostiziere ich eine 'Unendlichkeits-Illusion'.
Das meint Folgendes: Zu den 'entgrenzten'
Verhältnissen gehört heute auch der Glaube (oder die Propaganda),
man könne die Zukunft unendlich kalkulierbar machen, mittels 'Big
Data', also gewaltiger Datensammlungen und Datenverwertungen im kommerziellen
Bereich (sie finden ja nicht nur bei den Geheimdiensten statt). Und
man könne Staatsschulden einfach unendlich in die Zukunft verschieben.
Das Phänomen sieht, nach meiner Diagnose, so aus: Wenn Waren-Tausch
und Geld-Kontrakte entgrenzt werden, wird auch die darin präsente
Abstraktion entfesselt. Aus dem 'normalen' Denken in abstrakter Allgemeinheit
wird ein 'verrücktes' Denken in abstrakter Unendlichkeit. Das
kann neben den Immobilien- und Staatsanleihen-Blasen auch fatale Illusions-Blasen
erzeugen.
Damit landet die zunächst so abstrakt erscheinende Abstraktions-Analyse
mitten im Konkreten: in der Gefahr des nächsten Crashs.
Freiheits-Chancen
Ein produktives kritisches
Vorgehen nimmt aber auch die im fatalen Ganzen angelegten Freiheits-Chancen
wahr. Es gibt sie: Simmel zeigte,
dass der Gebrauch von Geld die gesellschaftlichen Beziehungen versachlicht.
Und Adorno behandelte die Tatsache, dass 'der Tausch' (bzw. der Waren-Handel)
zwar fatale Folgen hat, aber zugleich Chancen der Entwicklung denkender
Subjekte, denkender Menschen enthält.
Die Theorie des Gelds, die ich anstrebe, ist kritisch - aber sie vermeidet
das pauschale Verdammen des Vorhandenen. Kritik kann nicht bloß in
moralischer oder politisch korrekter Empörung bestehen oder darin,
dass man sich auf eine von außen aufs Material aufgesetzte 'Ethik'
oder 'Wertorientierung' beruft.
Das kritische Vorgehen findet freiheitliche Maßstäbe - als
'Alternativen' - im Waren-Tausch und im Geld-Kontrakt selbst; in den
Maximen, die darin strukturell angelegt sind: den Maximen des rationalen
Vergleichs, der egalitären Gerechtigkeit und der rationalen Bonität.
Damit wird es der kritischen Theorie des Gelds auch möglich, Lösungsvorschläge
für eine freiheitliche, rationale Identität des Gelds zu
machen.
Darum geht es.
Nach oben |