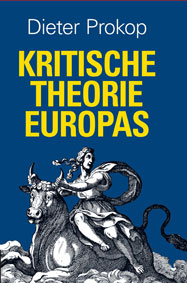Dieter
Prokop (2015): Kritische
Theorie Europas. Tectum Verlag, Marburg /
ISBN: 978-3-8288-3618-1
Eine
kritische Theorie Europas muss mehr liefern
als idealisierte Entwürfe oder empörte Feststellungen
Wozu
noch ein Buch, wo man doch alle Informationen auch bei Wikipedia und
auch sonst im Internet
erhalten kann? Tatsächlich gibt es
dort genug Stichwörter über alle Aspekte von Europa. Die
Fülle und der Detailreichtum sind beeindruckend. - Nur bewegt
sich die Darstellung meistens im Bereich des WAS und des WIE. Mir
geht es um das WARUM. Ich möchte den Blick auf die Hintergründe.
Ich möchte wissen, warum Europa nicht das wird, was es einmal
werden sollte: empfänglich für die vielen unterschiedlichen
Kulturen, offen für Völkerverständigung, demokratisch
und tolerant, und das nicht nur gegenüber Minderheiten, sondern
auch gegenüber Mehrheiten. Um das WARUM zu erkennen, muss man
die Gegensätze, die Widersprüche und die Dilemmata untersuchen,
von denen die europäische Integration geprägt ist.
Gegen die unvermeidliche Tatsache, dass man die Welt immer aus einer
Perspektive betrachtet, möchte ich dadurch angehen, dass ich meine
Einschätzung auf Analysen von Rechtswissenschaftlern, Journalisten,
Wirtschaftswissenschaftlern, Finanzwissenschaftlern, Literaturwissenschaftlern,
Sozialwissenschaftlern und Philosophen stütze, und zwar möglichst
aus allen fachwissenschaftlichen, politischen, journalistischen Lagern.
Was zählt, ist die realitätstüchtige Sachanalyse, und
wer dazu beiträgt, ist mir recht.
Und noch etwas verspreche ich: In diesem Buch werden die Sachen im
Klartext dargestellt. Ich werde meine Darstellung nicht in einem Fachjargon
verklausulieren, und all die beschönigenden Wörter, die in
den Debatten herumschwirren, werden auf das zurückgeführt,
was sich in der Realität dahinter verbirgt.
Man könnte annehmen, dass eine 'kritische Theorie Europas' eine
politische Philosophie sein wird. Aber in der Philosophie der Politik
geht es um normative, ideale Entwürfe, und das reicht nicht. Notwendig
ist eine realistische Analyse der empirischen Realität Europas.
Die politische Philosophie
war und ist weniger an der Analyse realer Macht-Mechanismen interessiert,
sondern mehr an idealen Entwürfen,
also daran, wie staatliche und gesellschaftliche Ordnung und Stabilität
zustande kommen sollten und welche Rolle der Staat oder auch die Wirtschaft
gegenüber dem Individuum spielen dürfen und mit welchem Recht
sie das dürfen oder nicht dürfen. Man berief sich auf das
Naturrecht, auf die conditio humana oder auf Menschenrechte. Oder auf
die Staatsraison oder auf einen rationalen Gesellschaftsvertrag, den
die Menschen-Wölfe eingehen.
Oder man berief sich umgekehrt - heute ist das in Europa beliebter
- auf einen allgemeinen Willen. Für Rousseau war die volonté générale
Bestandteil eines 'moralischen Vertrags' (contrat social) des Volks
untereinander. Damit war kein rationaler Gesellschaftsvertrag gemeint,
sondern ein moralischer ('social' hat im Französischen auch die
Bedeutung 'moralisch'), in dem jeder Einzelne sich mit all seinen Rechten
total der Gemeinschaft übereignet. Rousseau: "Denn wenn jeder
sich vollkommen hingibt, ist erstens die Lage für alle die gleiche,
und wenn die Lage für alle die gleiche ist, hat keiner ein Interesse
daran, sie den anderen beschwerlich zu machen. [...] Jeder von uns
unterstellt der Gemeinschaft seine Person und alles, was sein ist,
unter der höchsten Leitung des allgemeinen Willens; und wir als
Körperschaft empfangen jedes Mitglied als vom Ganzen unabtrennbaren
Teil."
"Wir als Körperschaft" - Die volonté générale
war ein idealisierter Entwurf, ein angeblich idealer, von Rousseau
jedoch stark idealisierter Gemeinsinn. Rousseau ging mit diesem 'Wir'
sogar so weit, dass diese 'Körperschaft' jene töten darf,
die sich dem allgemeinen Willen, dem idealen (von Rousseau idealisierten)
Gemeinsinn nicht einfügen. Rousseau: "Und wenn jemand, der
sich öffentlich zu eben diesen Dogmen bekannt hat, sich verhält,
als wenn er sie nicht glaube, so soll er mit dem Tode bestraft werden."
Voltaire schrieb dazu eine Bemerkung an den Rand seines (bis heute
erhaltenen) Du Contrat Social-Exemplars: "Das Ganze ist falsch.
Ich übergebe mich nicht meinen Mitbürgern ohne Vorbehalt.
Ich gebe ihnen nicht die Macht, mich nach der Stimmenmehrheit zu töten
und zu bestehlen. Ich unterwerfe mich, um ihnen zu helfen und um geholfen
zu bekommen, um Gerechtigkeit zu üben und erwiesen zu bekommen.
Keine anderen Übereinkommen."
Das ist durchaus aktuell:
Haben die EU-Kommission und das Europäische
Parlament das Recht, zu Gunsten ihres idealisierten Entwurfs, der 'europäischen
Wertegemeinschaft', in Kauf zu nehmen, dass die überstürzte
Assoziierung der Ukraine an die EU dort einen Krieg auslöst, also
Menschen getötet werden? Nein! Hat die Europäische Zentralbank
das Recht, durch extreme Niedrigzinspolitik die Sparer um ihr Erspartes
zu bringen? Nein! Und wenn Voltaire sich freiwillig unterwerfen wollte,
um 'zu helfen und um geholfen zu bekommen', hatte er sich sicherlich
nicht den Europäischen Stabilitäts Mechanismus (ESM) vorgestellt, über
den zwar die Euro-Nordstaaten den Euro-Südstaaten beim Schuldenzahlen
helfen, von dem aber die Steuerzahler der Euro-Nordstaaten nicht geholfen
bekommen, sondern im Gegenteil in Haftung genommen werden.
Hobbes (1651) sah das Wölfische im Menschen, das jedoch aus Eigeninteresse
auch in rationalen Vertragsverhältnissen zähmbar ist. Adam
Smith (1776) sah in der Eigenliebe (der Orientierung am eigenen Vorteil)
sogar etwas wirtschaftlich und gesellschaftlich Produktives, weil das
Arbeitsteilung ermöglicht.
Dagegen setzte Kant (1788) auf die Gesinnungen, darauf, dass die Menschen
damit aufhören, sich als Mittel zum Zweck anzusehen. John Rawls
(1975) hat die Prinzipien der Gerechtigkeit extrapoliert und hierbei
auf 'Fairness' gesetzt, Habermas (1996) hat eine Diskursethik entwickelt
und dabei auf die moralische Pflicht aller zur Beratschlagung ('Deliberation')
gesetzt.
Das Problem bei diesen Entwürfen sehe ich in der Losgelöstheit
der Theorien vom Bereich des Empirischen. Im Klartext: in der Losgelöstheit
von der Realität.
Das
empirische Europa - das sind Machtstrukturen. Einer der ersten, der
sich auf die empirischen
Machtstrukturen einließ, war vor
fast 500 Jahren Machiavelli. Er untersuchte, unter welchen strukturellen
Bedingungen Herrscher erfolgreich waren (s. Machiavelli 1532a, 1532b).
Selten war der Erfolg Herrschern beschert, die sittlichen Prinzipien
folgten. Machiavelli beobachtete, wie in der Politik letztlich der
Zweck der Macht-Eroberung und Macht-Erhaltung die Mittel heiligt. Er
beobachtete die außersittlichen, 'tierischen', animalischen Mechanismen
der Herrschaftssicherung: die Strategie des Löwen, der die Wölfe
durch Macht und Gebrüll abschrecken kann, und Strategie des Fuchses,
der die Wölfe durch List besiegt.
Machiavelli ist durchaus aktuell. Heute geht es zwar offiziell um Herrschaftssicherung
durch Recht - doch heute wird Herrschaftssicherung auch durch trickreich überdehnte
Rechts- und Vertragsauslegungen und auch durch Vertragsverletzungen
betrieben.
Machiavelli betrachtete das Ganze zwar
empirisch, also die realen Vorgänge,
aber er stellte sich auf die Seite der Herrscher und gab ihnen Ratschläge
zur Machterhaltung (s. Kapitel 101). Heute findet sich dieser 'Machiavellismus'
zum Beispiel in der Betrachtung des Ganzen als 'System', in der sich
die Betrachter dann - z.B. bei der Frage der europäischen Integration
- auf die Seite der 'Systemlogik' stellen und auf den Standpunkt, es
gebe 'funktionale Erfordernisse 'des Systems', 'systemisch Relevantes',
für deren Erhaltung man auch Verträge verletzen dürfe.
Wenn man jedoch Einsicht in die strukturelle Logiken gewinnen, aber
die Herrscherperspektive nicht einnehmen möchte, dann muss man
die Fakten genau studieren.
Aber das 'Wühlen in der Empirie' darf auch nicht dazu führen,
dass man in den Tatsachen-Feststellungen versinkt. Sicher, es gibt
ganz ausgezeichnete, detailreiche Fakten-Feststellungen. Aber so wie
die philosophischen Entwürfe sich zu sehr außerhalb der
Sachen bewegen, bewegen sich die Tatsachen-Feststellungen oft zu sehr
innerhalb. Man braucht ein Denken, das der Realität gerecht werden
kann, ohne gegenüber dem, was da ist, in Apologie zu enden.
Manchmal münden Tatsachen-Feststellungen auch nicht in Apologie,
sondern sie werden in empörtem Ton vorgetragen, mit der Larmoyanz
dessen, der alles besser machen würde, wenn man ihn an die Hebel
der Macht ließe, was man leider nicht tut. Aber auch empörte
Tatsachen-Feststellungen über stattgefundene oder stattfindende
'Realpolitik' genügen nicht.
Ich meine: Ein Denken, das
sich um Realitätsgerechtigkeit bemühte,
um die in der Empirie, der Realität bestehende Widersprüchlichkeit
und Dialektik - das leistete die kritische Theorie Horkheimers und
Adornos. Auch sie hatten moralische Prinzipien, kurz gesagt: 'die befreite
Gesellschaft'. Aber ihr kritisches Interesse richtete sich nicht auf
idealisierte Entwürfe, sondern darauf, herauszufinden, warum das
Bessere nicht zustande kommt.
Darum geht es auch in Bezug auf Europa.
Nach oben |