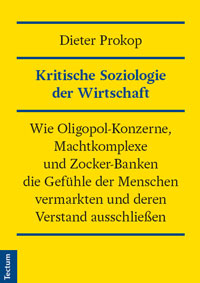PROKOP, Dieter
(2013): Kritische Soziologie der Wirtschaft. Wie Oligopol-Konzerne,
Machtkomplexe und Zocker-Banken die Gefühle
der Menschen vermarkten und deren Verstand ausschließen. Marburg
/ ISBN 978-3-8288-3094-3
Klappentext:
Die Kritische Soziologie
der Wirtschaft ist ein Buch, das die Strukturen der Realwirtschaft
und die Machenschaften der Finanzwirtschaft unbeirrt
von den üblichen beschönigenden Begriffen durchleuchtet.
Dieter Prokop stellt dar, wie die heutige Wirtschaft funktioniert:
Die Realwirtschaft findet im Oligopol statt. Konzerne vermeiden eine
Preis- und Qualitätskonkurrenz, und sie kooperieren informell,
wenn es um Preiserhöhungen geht. In der Finanzwirtschaft sind
die Oligopol-Banken zu Wettbüros geworden, was die Ursache
der gegenwärtigen Krisen ist. Außerdem stellt Prokop die
Machtkomplexe dar, die daran arbeiten, die Vermarktungs-Interessen
der Konzerne durchzusetzen.
Prokop sieht in den Verkaufsstrategien der Oligopol-Konzerne und auch
der Investmentbanken eine 'Operation Strukturierte Produkte', deren
Absicht die Irrationalisierung und Täuschung der Marktteilnehmer
ist. Und er fordert, dass man, statt von 'Gier und Furcht', 'Herdentrieb'
und 'Massenpsychologie' zu reden, die Realität zur Kenntnis nehmen
sollte. Dazu gehört das ökonomische, politische und gesellschaftliche
Umfeld. Prokop betont, dass dazu auch die Rationalität Marktteilnehmer
gehört.
Prokop zeigt auch, dass die sozialphilosophische Grundlage aller Regulierung
der Wirtschaft der rationale Gesellschaftsvertrag sein muss und nicht
die 'Einbettung' der Wirtschaft in Wertorientierungen, Konventionen,
Institutionen, wie sich das die 'Institutional Economics' und auch
die konventionelle Wirtschaftssoziologie vorstellen.
Schlusskapitel:
Kapitel 44:
Zusammenfassung und Lösungsvorschläge
Kritische Soziologie der Wirtschaft
Das Soziologische an diesem
Buch besteht in dem Versuch, hinter die Kulissen zu blicken. Über wirtschaftliches Handeln gibt es heute
eine Fülle von Ideologien - 'massenpsychologische' bis physiologische
('Hirnforschung') -, die den Marktteilnehmern irrationale bis unbewusste
Motive unterstellen. Und die Realität wirtschaftlicher Strukturen
wird heute mittels eine Fülle von beschönigenden Wörtern übertüncht.
Das sind die Kulissen. Dahinter befinden sich die Rahmenstrukturen
- und das sind Strukturen der Macht.
Wirtschaft ohne Macht ist unmöglich. Selbst die kreativsten Produktionsprozesse
erfordern Machtstrukturen. Jedoch ist Monopol-Macht wirtschaftlich,
politisch, gesellschaftlich nicht wünschenswert. Und die Macht
von Konzernen im Oligopol ist zumindest fragwürdig, jedenfalls
wenn man von der Vorstellung ausgeht, dass wirtschaftliche Prozesse
so etwas ermöglichen sollen wie eine Auslastung und Entfaltung
von Produktivkräften, Vollbeschäftigung, Vielfalt, Freiheit
etc. und nicht Austerität, Stagnation, Arbeitslosigkeit, Umweltschäden,
perfide Vermarktungsstrategien und bedrohliche Krisen.
Wie Oligopol-Konzerne, Machtkomplexe und Zocker-Banken ...
In oligopolistischen und
oligarchischen Wirtschaftsstrukturen besteht Macht darin, Andere
von der Produktion und Distribution ausschließen
zu können. Oligopole und Oligarchien ermöglichen die 'Operation
Ausschluss'. Da werden Barrieren errichtet:
I: Markteintritts-Barrieren
im Oligopol für weniger Kapitalkräftige.
(s. Kapitel 10)
II: Marktforschungs-Barrieren gegenüber dem Verstand der Konsumentinnen
und Konsumenten. (s. Kapitel 14)
III: Investitions-Barrieren bei Banken und Investoren gegenüber
der Realwirtschaft, der Infrastruktur und den gemeinnützigen Aufgaben.
(s. Kapitel 26)
IV: Politische Barrieren gegenüber der Regulierung der Wirtschaft
im Rahmen der postfordistischen Gegenreform. (s. Kapitel 33)
... die Gefühle der
Menschen vermarkten ...
Oligopolisten der Realwirtschaft
und der Finanzwirtschaft sind in der Lage, alles, was den Verkauf
fördern könnte, schon im
Stadium der Produktplanung in die Produkte einzubauen. Und es ist die Überzeugung
der Manager, dass man am Besten fährt, wenn man in die Produkte
Gefühlswerte einbaut. Denn die Manager glauben daran dass Konsumenten,
Publika und auch Investoren kreuzdumm, wenn nicht gar von unbewussten
Instinkten gesteuert sind. (s. Kapitel 1, 2 und 13)
Oder genauer: Sie tun so als würden sie daran glauben, weil das
eben die im kulturindustriellen Machtkomplex eingespielte Konvention
ist. So wie Keynes das in dem Zitat über die Konventionen sagte:
Wir halten uns an die Konventionen, aber das bedeutet nicht, dass wir
wirklich daran glauben.
Deshalb gibt es die 'Operation Strukturierte Produkte':
I: Verkaufsförderung von Waren durch künstliche Obsoleszenz
und durch Einbau von abstrakten, gebrauchswertlosen Gefühlswerten.
(s. Kapitel 11)
II: Verkaufsförderung von Waren und Werbung durch eine Konstruktion
von Zielgruppen und Milieus, die selektiv das Interesse am Ansprechen
von Gefühlen bedient. (s. Kapitel 13)
III: Verkaufsförderung von Finanzprodukten durch Verschleierung
von Risiken. Collateralized Debt Obligations (CDO). (s. Kapitel 23)
IV: Verkaufsförderung von Finanzprodukten durch Einbau eines Gefühlswerts,
der Furcht, in die Software beim algorithmusgesteuerten Hochfrequenzhandel.
- Diese Art von Verkaufsförderung fand allerdings nur in einem
Krimi statt, nicht in der Realität. Denkbar ist jedoch, dass auch
das irgendwann in der Realität versucht wird. (s. Kapitel 32)
... und deren Verstand ausschließen
Die Rationalität der Menschen besteht in ihrer Fähigkeit,
ihren Verstand so zu gebrauchen, dass sie die Bedeutung und Angemessenheit
ihrer Handlungen einzuschätzen wissen. (s. Kapitel 6) Diese Fähigkeit
wird von den Oligopol-Konzernen, von den an den Machtkomplexen Beteiligten
und von den Zocker-Banken ausgeschlossen.
Oder genauer: Sie versuchen, den Verstand der Menschen auszuschließen,
in ihren Produkten, in ihrer Werbung, in ihrer Public Relations und
Lobbyarbeit. Ich habe jedoch darauf hingewiesen, dass dieser organisierte
Versuch, die Gefühle zu vermarkten, nicht zwangsläufig die
gewünschten Effekte hat: Die Absicht der Manipulation ist noch
lange keine reale Manipulation, die Leute sind ja nicht dumm. (s. Kapitel
15)
Dabei sind Gefühle und Verstand empirisch nicht trennbar, selbst
wenn kommerzielle Forschungsfirmen genau diese Trennung der Realität
aufzustülpen versuchen. (s. Kapitel 13 und 14) In allen Gefühlen
arbeitet der Verstand mit, und wenn er menschlich - also nicht-instrumentell
- arbeitet, impliziert der Verstand auch Gefühle.
Hier muss man sich die Produkte, über die man urteilen möchte,
sehr genau ansehen, Es gibt Produkte, Waren, die bloß Gefühlswerte
vermarkten und den Verstand der Käufer bzw. des Publikums ausschließen.
- Und es gibt Produkte, auch im Rahmen oligopolistischer Marktstrukturen,
die sowohl die Gefühle als auch den Verstand ansprechen, vielleicht
sogar beides weiterentwickeln. (s. Kapitel 16) Es gibt ja immer mal
Nischen der Freiheit, die sich zum Beispiel besonders kommerziell erfolgreiche
Autoren, Regisseure, aber auch Trader, Investoren etc. gegenüber
den auf Rationalisierung und Formalisierung drängenden Managements
schaffen können.
Lösungsvorschläge
Es gibt viele Forderungen,
denen ich mich, aufgrund meiner Analyse, anschließen kann: Notwendig sind Märkte mit freier Konkurrenz
und freiem Zugang zur Distribution. Notwendig ist mehr Mitbestimmung
auch in den Aufsichtsräten der Banken. Geschäftsbanken müssen
von Investmentbanken getrennt werden, wie das in den USA mit dem Glass-Steagall-Gesetz
von 1933 bis 1999 der Fall war. Die staatlichen Aufsichtsbehörden
müssen ihre Aufgaben auch wirklich wahrnehmen, und hierzu brauchen
sie mehr und mehr qualifiziertes Personal. Sie müssen auch die
Zweckgesellschaften, die Schattenbanken, die Hedgefonds kontrollieren.
Es müssen neutrale und sachkundige Rating-Agenturen eingerichtet
werden. Im Krisenfall dürfen Banken nur Hilfen erhalten, wenn
sie temporär verstaatlicht werden (wie das in den USA praktiziert
wurde). Außerdem müssen Gesetze befolgt werden. Das betrifft
zum Beispiel die Sozialbindung des Eigentums im Grundgesetz, aber auch
die europäischen Verträge, die die Schuldenbremse und die
No Bailout-Klausel gesetzlich festgeschrieben haben. Das betrifft auch
die EZB, die keine Finanzierung verschuldeter Staaten (auf Kosten der
Steuerzahler anderer Staaten) betreiben darf. Außerdem sollten
beim algorithmusgesteuerten Hochfrequenzhandel bestimmte Algorithmen
verboten werden, die unkalkulierbare Risiken enthalten, weil sie plötzliche
Krisen verursachen könnten. (Und nicht zuletzt hängt viel
davon ab, ob es gelingt, eine neue Welt-Ordnung für das Währungs-
und Finanzsystem zu finden.)
Das sind Vorschläge von kritischen Wirtschaftswissenschaftlern,
Finanzexperten, Wirtschaftsjournalisten.
Aber welche Lösungsvorschläge ergeben sich speziell aus der
kritischen Soziologie der Wirtschaft? Sie ergeben sich, wenn man über
das Gegenteil des kritisch Analysierten nachdenkt. Wenn man sich also
zur Operation Ausschluss, zur Operation Strukturierte Produkte und
zum Versuch, den Verstand der Menschen auszuschließen, jeweils
das Gegenteil vorstellt:
Das Gegenteil der 'Operation
Ausschluss' ist die 'Operation Chancengleichheit': freier Zugang
von Unternehmen zu Ressourcen und Märkten.
Die Operation Chancengleichheit impliziert den freien Zugang zur Produktion.
Das muss kein utopisches Ideal sein. Mehr Chancengleichheit könnte
zum Beispiel auch durch ausreichende Kredite für die mittelständische
Wirtschaft und für Unternehmensgründungen geschaffen werden.
Die Operation Chancengleichheit bedeutet auch den freien Zugang zur
Distribution, zu Märkten. Und eine nachhaltige parlamentarisch-demokratische
Regulierung der Wirtschaft.
Das Gegenteil der 'Operation
Strukturierte Produkte' ist - im Bereich der Produktion - die 'Operation
Unabhängigkeit': weniger Kontrolle,
autonome Arbeitsbedingungen, so frei, wie das sachlich möglich
ist.
Die Operation Unabhängigkeit impliziert, dass diejenigen, die
die Produkte entwerfen und herstellen, nicht von autoritären Managements
kontrolliert werden. Sie haben Spielräume. Sie können frei
entwerfen und produzieren - was zweifellos auch (wenn nicht sogar mehr)
kommerziellen Erfolg bringt.
'... so frei, wie das sachlich möglich ist' - Nicht immer ist
das möglich. Oft erfordert die Sache auch Arbeitsteilung, Anweisungs-Strukturen,
Hierarchien, Machtstrukturen. Und natürlich meine ich auch nicht,
dass man die Trader, die in den Banken und Schattenbanken mit den Millionen
und Milliarden spielen, von der Kontrolle durch das Risikomanagement
befreien sollte, im Gegenteil. Es ist jedoch ein Unterschied,
ob zum Beispiel Redaktionen mit unabhängig denkenden und arbeitenden
Journalisten besetzt sind (die ihre Unabhängigkeit vertraglich
garantiert erhalten)
oder mit Journalisten, die - in Redaktionen als 'Profit-Centers', 'Exzellenz-Centers'
- von Marketing-Fachleuten beherrscht werden . oder sich selbst als
Marketing-Fachleute verstehen.
Das Gegenteil des Ausschlusses des Verstands der Menschen ist die
'Operation Respektierung des Verstands der Menschen': mehr realer Gebrauchswert,
mehr Transparenz, mehr Demokratie.
Die Operation Respektierung des Verstands der Menschen impliziert im
Bereich der Produktion die Herstellung von Produkten, wie sie die Verbraucherschutzverbände
fordern: von nützlichen und durchschaubaren Produkten, die realen
Gebrauchswert haben und die mit klaren Informationen über den
Inhalt versehen sind. Und eine Werbung, die gut informiert - oder die
klar macht, dass Sachinformation nicht ihr Interesse ist, sondern das
Schaffen von Aufmerksamkeit durch ungehinderte, nicht von Image-Erfordernissen
gefesselte Kreativität.
Die Operation Respektierung des Verstands der Menschen impliziert auf
der politischen Ebene impliziert diese Operation, dass die Regierungen
die Menschen als die mündigen Bürger behandeln, die sie sind.
(Selbst wenn sie nicht permanent in das politische Geschehen eingreifen
wollen und können, s. Kapitel 37) Auch das ist keine utopische
Forderung: Die Respektierung des Deutschen Bundestags wurde zum Beispiel
im Urteil vom 12. September 2012 (s. Chronik im Anhang) auch vom Bundesverfassungsgericht
gegenüber den europäischen Regierungs-Instanzen angeordnet.
(Selbst wenn die Vorstellung, die mündigen Bürger könnten
sich über ihre gewählten Vertreter im Parlament Gehör
verschaffen, angesichts der Verselbständigung von Rackets, von
Macht-Cliquen in den Parteien, eine Fiktion ist, so ist das doch eine
notwendige, auf Realisierung drängende Fiktion.)
Also: Es kann kann nicht
schaden, wenn auch mal ein Soziologe, zusätzlich
zu den operationalisierten Lösungsvorschlägen der kritischen
Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftsjournalisten, emphatisch
ausruft: Mehr Chancengleichheit! Mehr Zugang auch kleinerer Unternehmen
zu Ressourcen und Märkten! Mehr Unabhängigkeit! Mehr autonome
Arbeitsbedingungen! Mehr nützliche und kreative Produkte statt
manipulativer Gefühls-Vermarktung und Käufer-Täuschung!
Mehr Transparenz! Mehr Respektierung des Verstands der Menschen! Mehr
Demokratie!
Nach oben |